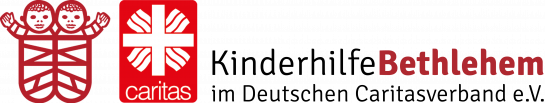Corona-Alltag einer Entwicklungshelferin in Jerusalem
Bisher war es kein Problem, in Bethlehem zu arbeiten und in der Jerusalemer Altstadt zu leben. Doch über Nacht galten in Palästina und Israel strikte Ausgangsbeschränkungen, um die Ausbreitung der Corona-Pandemie zu verhindern. Selbst Berufspendlerinnen wie mir ist es untersagt, nach Bethlehem zu fahren. Seither erledige ich meine Arbeit, wie so viele Menschen auf der Welt, aus dem Homeoffice.
Mein Arbeitszimmer ist lichtdurchflutet – was in den eng aneinander und übereinander errichteten Häusern der Altstadt nicht selbstverständlich ist. Als Arbeitsplatz meiner möblierten Wohnung dient der Schminktisch meiner Vermieterin. Die instabile Internet- und Telefonverbindung in Ostjerusalem sorgt für zahlreiche Frustrationsmomente. Meine Kolleginnen im Caritas Baby Hospital erreiche ich oft erst nach mehreren Versuchen. Alles braucht mehr Zeit als sonst. Gerade als Mitarbeiterin im Bereich Kommunikation fehlt es mir, am Puls des Geschehens im Krankenhaus zu sein und Informationen aus erster Hand liefern zu können.
Gassen der Altstadt sind leergefegt
Wer jemals die Altstadt Jerusalems besucht hat, kennt das Gedränge in den Gassen, die intensiven Gerüche von Gewürzen, Gebäck und Kaffee, die lebendigen Farben sowie das Meer aus Geräuschen – und die starke Präsenz des israelischen Militärs. Durch die Ausgangsbeschränkungen war Jerusalem wochenlang wie ausgestorben, die Gassen sind leergefegt. Mit Ausnahme einiger Anwohner, die nach essentiellen Einkäufen verstohlen nach Hause eilten. Nur einmal verstieß ich selber gegen die Bestimmungen: An meinem Geburtstag traf ich hinter einem Lebensmittelgeschäft heimlich eine Freundin auf ein Eis.
Vor kurzem wurden die Restriktionen in Jerusalem gelockert. Schrittweise öffneten verschiedene Geschäfte, sportliche Aktivitäten oder Spaziergänge dürfen nun in einem Radius von 500 Metern vom Haus entfernt stattfinden. Dafür ist das Tragen einer Maske zur Pflicht erklärt worden. Größere Menschenansammlungen und die Wiedereröffnung von Cafés, Restaurants und Bars bleiben untersagt. Das mit dem islamischen Fastenmonat Ramadan verbundene abendliche Zusammenkommen zum Iftar, dem gemeinsamen Abendessen, bleibt dieses Jahr aus.
Solidarität trotz großer Sorgen
Normalität ist in Jerusalem mit Sicherheit noch nicht wieder eingekehrt, wenn auch einige Gründe zum vorsichtigen Aufatmen bestehen. Der palästinensischen Bevölkerung Ostjerusalems und des Westjordanlandes bereiten die wirtschaftlichen Auswirkungen der Restriktionen große Sorgen. Vielen Familien mangelt es, insbesondere im Westjordanland, an finanziellen Rücklagen. Fast alle Arbeitsbereiche sind zum Erliegen gekommen, Ersparnisse haben die meisten nicht, eine Sozialversicherung gibt es hier nicht. Verschiedene muslimische, christliche und säkulare Institutionen versuchen, die wirtschaftlichen und sozialen Folgen für benachteiligte Familien zu mildern.
Auch die Sozialdienstabteilung des Caritas Baby Hospitals greift nun einer größeren Anzahl von Familien bei der Finanzierung der medizinischen Versorgung oder der Medikamente für ihre Kinder unter die Arme.
Wie das Leben der Bevölkerung sich hier in den kommenden Monaten verändern wird, lässt sich kaum vorhersagen. Aber es ist beeindruckend mitzuerleben, wie die palästinensische Gesellschaft in diesen schwierigen Zeiten zusammenhält und Wert auf Solidarität unter Familien, Nachbarn und sogar Fremden – wie mir – legt.